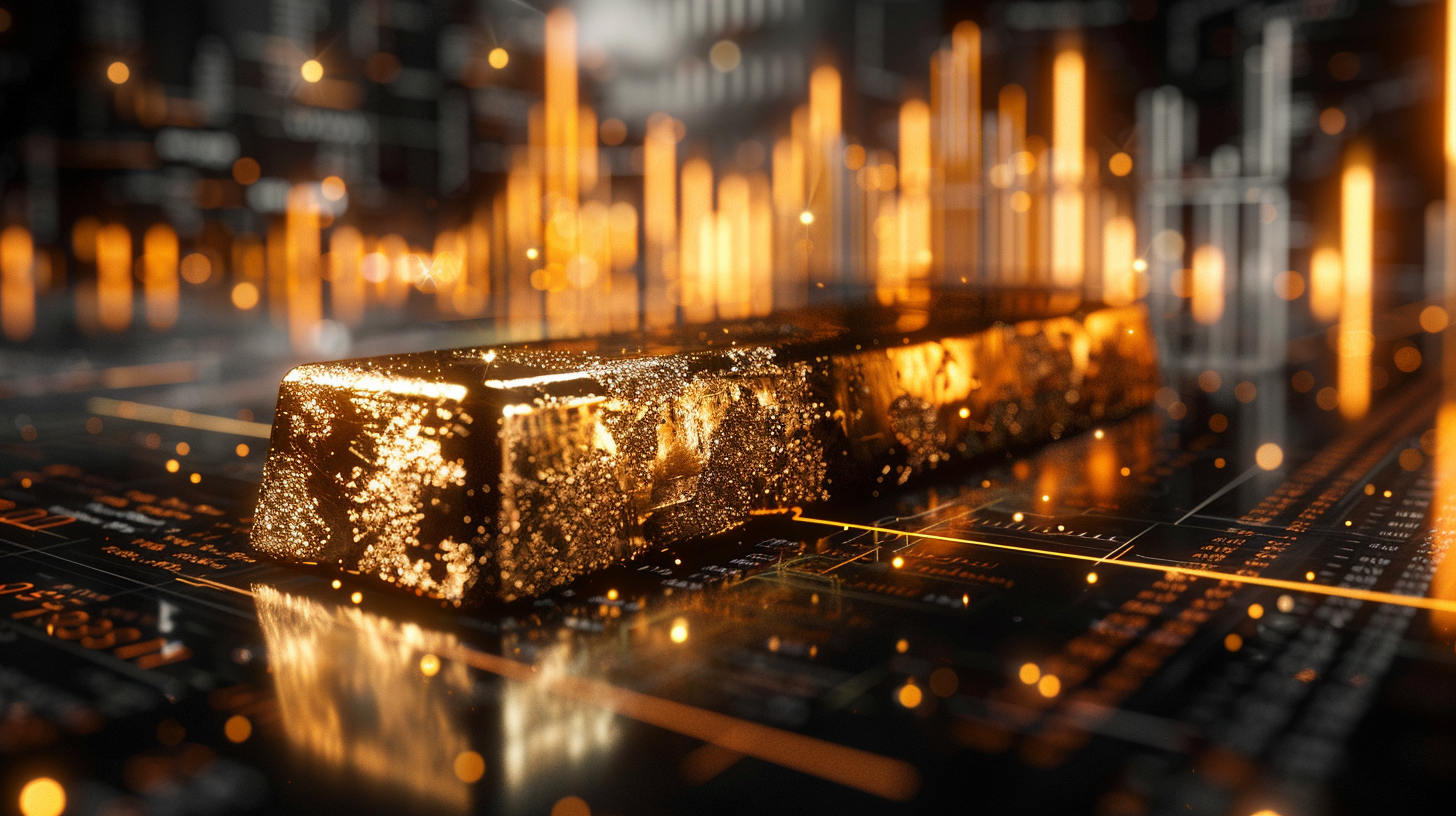Sind die Tage der Cent-Münzen gezählt?
Vor etwa einem Jahr haben wir über die Bestrebungen einzelner Euro-Länder berichtet, die kleinen Cent-Münzen abzuschaffen – und wir haben erklärt, warum die ganz große Bargeld-Abschaffung höchstwahrscheinlich im Kleinen beginnt. Inzwischen ist das Thema auf die ganz große Agenda gekommen – sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Europa: Während US-Präsident Donald Trump dem „Penny“ den Kampf angesagt hat, spricht sich das Nationale Bargeldforum in Deutschland für die Abschaffung der kleinen Cent-Münzen aus.
Während Befürworter hohe Herstellungskosten und Bequemlichkeit an der Kasse betonen, warnen Kritiker vor Preissteigerungen und dem schleichenden Rückzug des Bargelds. Estland hat 2025 mit einer Rundungsregel Fakten geschaffen – ein Modell für Europa?
Warum überhaupt abschaffen?
Die kleinsten Cent-Münzen verursachen hohe Kosten und gelten als unpraktisch im Alltag. Befürworter der Abschaffung führen verschiedene Argumente an:
- Hohe Herstellungskosten: Laut Bundesbank kostet die Produktion von 1- und 2-Cent-Münzen oft mehr als ihr Nennwert. Das Prägen dieser Münzen ist also wirtschaftlich ineffizient.
- Hohe Umlaufverluste: Viele kleine Münzen verschwinden in Sparschweinen oder gehen verloren, weshalb Zentralbanken ständig neue Münzen nachprägen müssen.
- Aufwendige Bargeldlogistik: Einzelhändler müssen hohe Kosten für Wechselgeldbestände und Bankeinzahlungen tragen, was die Effizienz verringert.
- Zeitersparnis an der Kasse: Kunden suchen nicht länger nach passendem Kleingeld, was die Bezahlvorgänge beschleunigt und Schlangen im Einzelhandel reduziert.
Estlands Vorbild: Rundungsregel statt Münzabschaffung
Seit dem 1. Januar 2025 rundet Estland Barzahlungen auf die nächsten fünf Cent auf oder ab. Die Eesti Pank begründet diesen Schritt mit mehreren positiven Auswirkungen:
- Weniger neue Münzen im Umlauf: Die Zentralbank gibt kaum noch 1- und 2-Cent-Stücke aus, da sie im Alltag überflüssig werden.
- Reibungslose Umstellung: Händler haben sich schnell an die neue Regelung gewöhnt, da sie durch entsprechende technische Anpassungen vorbereitet waren.
- Kein nachweisbarer Preisanstieg: Statistiken zeigen keine systematischen Preissteigerungen durch die Rundungsregel – eine zentrale Befürchtung vieler Kritiker bleibt damit unbegründet.
- Mehr Kleingeld im Umlauf: Viele Verbraucher bringen gehortete Münzen zur Bank oder geben sie im Handel aus, da sie weniger nützlich sind als zuvor.
Kritik an der Abschaffung
Obwohl sich viele für eine Abschaffung oder Reduzierung der Cent-Münzen aussprechen, gibt es erhebliche Gegenargumente:
- Versteckte Preiserhöhungen: Händler könnten Preise strategisch so gestalten, dass sie tendenziell eher aufgerundet werden, was Verbraucher langfristig benachteiligen könnte.
- Soziale Aspekte: Kleingeld wird häufig für Spenden genutzt. Das Wegfallen von 1- und 2-Cent-Stücken könnte dazu führen, dass weniger Münzen in Spendenboxen landen oder Straßenmusiker und Bedürftige weniger erhalten.
- Bargeldfreiheit in Gefahr? Kritiker befürchten, dass der schrittweise Wegfall von Bargeldnominalen eine Tür zur vollständigen Abschaffung des Bargelds öffnen könnte, was Datenschutzbedenken und Abhängigkeitsprobleme bei digitalen Zahlungsmethoden verstärkt.
Wie handhaben es andere Länder?
Während in Europa die Debatte noch läuft, gibt es weltweit bereits unterschiedliche Lösungen für Kleinmünzen:
- Finnland & Niederlande: Seit Jahren existieren Rundungsregeln auf fünf Cent, wobei Kleinstmünzen kaum noch im Umlauf sind.
- USA & Kanada: In Kanada wurden 1-Cent-Stücke 2013 abgeschafft, und Zahlungen werden konsequent gerundet. In den USA gibt es zwar eine Debatte über das teure Penny, aber noch keine konkreten Abschaffungspläne.
- Australien & Neuseeland: Diese Länder haben bereits vor Jahrzehnten ihre kleinsten Münzen abgeschafft, ohne größere wirtschaftliche oder gesellschaftliche Probleme.
- Japan: Die 1-Yen-Münze bleibt weiterhin im Umlauf, da sie einen wichtigen symbolischen und funktionalen Wert im Handel besitzt.
Fazit
Die Abschaffung kleiner Cent-Münzen bleibt ein kontroverses Thema. In Österreich genießt Bargeld nach wie vor eine hohe Akzeptanz und wird von vielen Menschen als bevorzugtes Zahlungsmittel genutzt. Laut Umfragen zahlen rund zwei Drittel der Österreicher ihre Einkäufe regelmäßig mit Bargeld, insbesondere bei kleineren Beträgen oder in ländlichen Regionen.
Die starke Verankerung von Bargeld in der Gesellschaft spiegelt sich auch in politischen und wirtschaftlichen Diskussionen wider: Die österreichische Regierung setzt sich aktiv für den Erhalt des Bargelds als gesetzliches Zahlungsmittel ein, und auch viele Unternehmen betonen die Bedeutung von Bargeld für eine freie und unabhängige Zahlungsinfrastruktur. Trotz des zunehmenden Trends zu digitalen Zahlungsmethoden bleibt Bargeld für viele Österreicher ein Symbol für finanzielle Sicherheit und Datenschutz.
Während wirtschaftliche Argumente für eine Reduzierung des Münzangebotes sprechen, gibt es berechtigte Bedenken hinsichtlich versteckter Preissteigerungen, sozialer Auswirkungen und der Zukunft des Bargelds. Die EU muss abwägen, ob eine einheitliche Lösung sinnvoll ist oder ob nationale Rundungsregeln wie in Estland und Finnland ausreichend sind. Klar ist: Der Abschied von den kleinen Cent-Stücken wäre mehr als nur eine technische Entscheidung – er könnte das Einkaufsverhalten, Preisgestaltung und die Bargeldkultur nachhaltig verändern.
Auswirkungen auf Edelmetall-Anleger
Vielleicht fragen Sie sich an dieser Stelle, was das alles mit Ihnen zu tun hat? Immerhin sind Sie womöglich kein Münzensammler, sondern Edelmetall-Anleger. Die schleichende Abschaffung des Bargelds könnte langfristig auch Goldanleger betreffen, da physisches Gold traditionell als Ersatzwährung und „ultimatives Bargeld“ gilt. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit oder bei Problemen im Finanzsystem greifen viele Menschen auf Gold zurück, um ihre Kaufkraft unabhängig von Banken und digitalen Zahlungssystemen zu sichern.
Wenn Bargeld schrittweise aus dem Alltag verdrängt wird und digitale Transaktionen zunehmend kontrolliert oder eingeschränkt werden, könnte dies auch den Handel mit physischem Gold erschweren – sei es durch strengere Regulierung, Einschränkungen bei anonymen Käufen oder neue steuerliche Vorgaben. Zudem könnte eine bargeldlose Gesellschaft den Trend zur vollständigen Digitalisierung von Währungen verstärken, wodurch die Funktion von Gold als wertbeständige Alternative zusätzlich unter Druck geraten könnte.